Politische Kultur der FPÖ 2000-2005
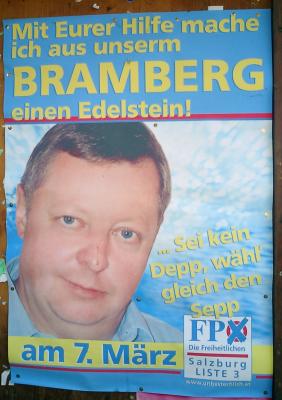
…ich sage das in aller Klarheit…
Sozialminister Herbert Haupt
"CLUB JÖRG"
DIE ELITEN DER FPÖ
DAS KABINETT SCHÜSSEL I
Die Angelobung der schwarz-blauen Bundesregierung
Freitag, 4. Februar 2000
Tausende Menschen demonstrieren in der Wiener Innenstadt. Das politische Experiment von Wolfgang Schüssel hat nur wenig Freunde. Schüssel hat sich mit Jörg Haider geeinigt. Das Kabinett Schüssel I wird angelobt. Die schwarz-blaue Regierung hat keinen guten Start: Die Regierungsmitglieder müssen aus Sicherheitsgründen unterirdisch in die Präsidentschaftskanzlei gebracht werden. Vor dem Bundeskanzleramt melden sich 5000 Menschen lautstark zu Wort. Diese Regierung ist unerwünscht. Die Live-Übertragung der Angelobung des ORF bricht mehrmals ab. In der Präsidentschaftskanzlei ahnt der damalige Bundespräsident, was auf Österreich zukommt. Er erkennt die personell dünne Decke des FPÖ-Regierungsteams. Mit eiserner Miene gelobt Thomas Klestil das Kabinett an. Der Bundespräsident kämpft bis zum Schluss gegen die schwarz-blaue Regierung. Jetzt muss er sie persönlich angeloben. Jörg Haider strahlt: der „Club Jörg“ kommt erstmals in die Bundesregierung. Dem Kabinett Schüssel I gehören neben Wolfgang Schüssel und Susanne Riess-Passer (FPÖ) die ÖVP-Minister Benita Ferrero-Waldner (Äußeres), Martin Bartenstein (Wirtschaft), Ernst Strasser (Inneres), Elisabeth Gehrer (Bildung, Wissenschaft, Kultur, Kunst) und Wilhelm Molterer (Landwirtschaft, Umwelt) sowie die FPÖ-Minister Karl-Heinz Grasser (Finanzen), Elisabeth Sickl (Soziales, Generationen), Herbert Scheibner (Verteidigung), Michael Schmid (Infrastruktur) und Michael Krüger (Justiz) an. Dazu kommen die ÖVP-Staatssekretäre Franz Morak (Bundeskanzleramt) und Alfred Finz (Finanzen) sowie die FPÖ-Staatssekretäre Reinhart Waneck (Gesundheit/Sozialministerium) und Mares Rossmann (Tourismus/Wirtschaft). Von den Personen, die FPÖ-Obmann Jörg Haider für Ministerposten vorgeschlagen hat, lehnte der Bundespräsident – erstmals in der Geschichte der Republik – bereits im Vorfeld zwei Kandidaten ab: Thomas Prinzhorn und Hilmar Kabas.
Thomas Prinzhorn: Der Subventions-Kaiser – vorgeschlagen für das Ressort Zukunft und Innovation – wird wegen seiner verbalen Entgleisung von Bundespräsident Klestil abgelehnt. Prinzhorn hat im Wahlkampf gemeint, "Asylanten und Ausländer haben eine ganze Reihe von Vorteilen. Sie bekommen zum Beispiel Medikamente zur Hormonbehandlung vom Sozialamt gratis, um ihre Fruchtbarkeit zu steigern…" Prinzhorn, Paradeunternehmer der FPÖ, ist das wirtschaftspolitische Aushängeschild für seine Partei. Der Papierbaron predigt die freie Marktwirtschaft. In eigener Sache nimmt der Papierfabrikant diese nicht sonderlich genau: als sein ererbtes Unternehmen in massiven wirtschaftlichen Problemen steckt, nimmt Prinzhorn in vielfältiger Weise Subventionen, Hilfen und Zuschüsse von der öffentlichen Hand.
Hilmar Kabas: Der "Hump-Dump-Lump" – vorgeschlagen für das Ressort Verteidigung – wird wegen dessen Wahlkampfführung in Wien von Bundespräsident Klestil abgelehnt. Der Wahlkampf der Wiener FPÖ erlebt unter seiner Obmannschaft einen neuen Tiefpunkt: Antisemitische Plakate und ausländerfeindliche Sprüche prägen das Wiener Straßenbild. 2004 nimmt Hilmar Kabas, seit 1998 an der Spitze der Wiener FPÖ, Abschied vom Landesparteivorsitz. Bekannt geworden ist er unter anderem durch die Forderung nach einem Zuwanderungs-Stopp, die "Hump-Dump-Lump"-Affäre, aber auch durch einen "Sicherheitslokalaugenschein" in einem Wiener Bordell.
Donnerstag, 17. Februar 2000
Der öffentliche Auftritt von Justizminister Krüger sorgt für Aufsehen. Bereits in den ersten Tagen wird klar, welche Personen hier an die Macht gekommen sind. Während die ÖVP Mannschaft im Wesentlichen stabil bleiben wird – einzige Ausnahme ist Innenminister Ernst Strasser, der im Dezember 2004 völlig überraschend zurücktritt –, lässt die FPÖ Mannschaft keinen Fettnapf aus. Rücktritte, Intrigen, Fehlentscheidungen, Ausrutscher und Peinlichkeiten prägen den Regierungsalltag der FPÖ. Die kleine Regierungsmannschaft demonstriert vom ersten Tag an Unfähigkeit. Das größte Problem der FPÖ ist das eigene Personal. Die ÖVP verfügt über eine weitaus größere Personaldecke. Hier machen sich Bünde und parteinahe Vorfeldorganisationen bezahlt. Die FPÖ hat ein massive Personalproblem. Kein vernünftiger – dazu noch fachlich versierter – Mensch stellt sich dem völlig unberechenbaren Jörg Haider zur Verfügung. Der Niedergang ist vorprogrammiert. Die Hochphase der FPÖ beginnt Ende der 90-er Jahre. Die Zahl der Freiheitlichen WählerInnen stieg auf mehr als eine Million ÖsterreicherInnen (1999 gaben 1,2 Millionen Menschen der Partei um Jörg Haider die Stimme). Einige Jahre später erfolgte der Einbruch. Bei der Nationalratswahl 2002 entschieden sich gerade noch 491.000 ÖsterreicherInnen für die FPÖ. Keine guten Voraussetzungen für versierte, unabhängige ExpertInnen, sich dieser Partei anzuschließen. Der rasche Aufstieg der FPÖ führt dazu, dass nicht nur qualifiziertes Personal bei der FPÖ anheuerte. Der Volkspartei im Kabinett Schüssel I wird dieses Manko bald bewusst. Die ÖVP muss der FPÖ personell unter die Arme greifen. MitarbeiterInnen in den FPÖ-Ministerien werden von ÖVP als "Amtshilfe" – etwa für die Öffentlichkeitsarbeit – zur Verfügung gestellt, weil FPÖ schlicht und einfach über keine Fachleute verfügt. Hauptproblem der FPÖ ist – so paradox es klingt – Jörg Haider. Haiders Einzelkämpfertum ist Ursache für den personellen und politischen Niedergang seiner Partei. Die Partei ist Jörg Haider. Neben ihm hat niemand Platz. Heide Schmid, Riess-Passer und Co zeigen, neben Haider hat niemand Raum. Die Firma Haider wird zum Familienbetrieb. Nur die ältere Schwester wird geduldet. Ein Großteil des Personals der FPÖ stammt aus Kärnten. Intelligenz, Haltung und Zivilcourage hatten in der FPÖ niemals Tradition. Die Ironie der Geschichte: Haider hat sich dadurch letztlich selbst zu Fall gebracht. Für die dünne Personaldecke der FPÖ gibt es einen Verantwortlichen: Jörg! In Oppositionszeiten fiel dieses Defizit nicht auf. Erst die Regierungsbeteiligung brachte es ans Licht. Wasserrechtler werden Justizminister. Landschaftsplaner, Lehrer oder Exportkaufleute werden Verkehrsminister. Ein Tierarzt wird Sozialminister. FP-Parteizugehörigkeit ist alles. Wer aus Kärnten kommt macht unweigerlich Karriere. Niemand fragt nach Qualität und fachlicher Kompetenz. Wer konnte, verließ rechtzeitig das sinkende Schiff: Josef Moser – Klubdirektor im Parlamentsklub – tauchte rechtzeitig ab. Moser wird über den Umweg als ÖBB-Manager (mit einer Traumgage von 211.000 Euro jährlich) schließlich wieder als Rechnungshofpräsident auftauchen. Moser, die einzige wirkliche Personalreserve der FPÖ, wird für alle Positionen ins Gespräch gebracht. Karl Heinz Grasser wechselte geschickt – als 'Parteiloser' versteht sich – zur Volkspartei und brachte durch diesen politischen Schachzug seinen Ministersessel und die Homepage in Sicherheit. Susanne Riess-Passer verschwand in die Privatwirtschaft. Peter Westenthaler versuchte es kurzfristig mit Fußball, um letztlich bei den Pferden von Frank Stronach zu landen. Dieter Böhmdorfer warf die Nerven weg und ging wieder in seine Anwaltskanzlei zurück. Heide Schmid, Volker Kier, Friedhelm Frischenschlager und Co haben es – Jahre zuvor – mit einer eigenen Partei versucht. Nicht wirklich erfolgreich. Alle haben eines gelernt: neben dem "Jörg" ist nicht viel Platz.
Der Fall Michael Krüger
Montag, 28. Februar 2000
Der Justizminister gibt nach nur 25 Tagen Amtszeit auf. Er ist damit Justizminister mit der kürzesten Amtszeit. Dr. Michael Krüger, Rechtsanwalt aus Oberösterreich. Jahrgang 1955. Aufgefallen ist Krüger in seiner kurzen Amtszeit als Justizminister nur durch den geplanten Ankauf eines Dienstjaguars. Krüger war mit dem Dienst-BMW, den er von seinem Vorgänger Nikolaus Michalek übernommen hat, nicht zufrieden. Der Fan für Porsche und Jaguar legt sein Amt als Justizminister aus „Überlastungsgründen“ zurück. Krüger geriet kurz davor durch ein "profil"-Interview in die Schlagzeilen. In diesem hatte sich Krüger mit einem Jugendfreund über seine Sexualpraktiken mit der Miss Vienna unterhalten.
Der Fall Elisabeth Sickl
Dienstag, 24. Oktober 2000
Die Sozialministerin geht. Dr. Elisabeth Sickl, Lehrerin aus Kärnten. Jahrgang 1940. Jusstudium an der Universität in Wien. Seit Februar FPÖ-Bundesministerin für Soziale Sicherheit und Generationen. Die glücklose Schlossbesitzerin aus Kärnten hatte es nicht besonders leicht. Öffentliche Auftritte waren nicht ihre Stärke. Nach rund 236 Tagen Amtszeit als Sozialministerin wirft sie im Oktober endgültig das Handtuch. Oder besser, der Club Jörg, nahm ihr das Handtuch weg. Herbert Haupt zog in das Sozialministerium ein. Das politische Erbe von Elisabeth Sickl ist nicht gerade berauschend. Sozialpolitische Aktivitäten sind nicht bekannt. Von der rund neunmonatigen Amtszeit Sickls ist nur der Beginn des Postenschachers im Sozialministerium dokumentiert. So kritisierte etwa der Rechnungshof die Bestellung der Leitung der Bundesanstalt für Lebensmitteluntersuchung in Wien mit Christine Weber. Weber war Pressesprecherin von Sozialministerin Sickl.
Der Fall Michael Schmid
Sonntag, 5. November 2000
Beim Infrastrukturminister ist der Akku leer. Dipl. Ing. Michael Schmid, Architekt aus der Steiermark. Jahrgang 1945. Seit Februar Infrastrukturminister der FPÖ. Schmid verlässt - nach rund 263 Tagen Amtszeit - die Bundesregierung. Er kommentiert seinen Abgang nur knapp: "Die Batterie ist leer". Die Turbulenzen innerhalb der FPÖ reißen nicht ab. Völlig überraschend gibt Michael Schmid seinen völligen Rückzug aus der Politik bekannt. Damit wurden seit Angelobung der schwarz-blauen Regierung nach exakt neun Monaten bereits drei der sechs FPÖ-Minister ausgewechselt. Als Nachfolgerin Schmids tritt Monika Forstinger an. Schmid sorgt Monate später mit seiner üppigen Politikerpension für Aufsehen. Seine Ex-Frau denkt nicht daran, auf die Pension zu verzichten. Die Optik ist schief. Der Club Jörg tobt. Ein Parteiausschluss liegt in der Luft. Schmid legt schließlich auch seine Parteimitgliedschaft zurück. Die politische Bilanz lässt auch bei Infrastrukturminister Schmid zu wünschen übrig. Die Verhandlungen im Zusammenhang mit dem Transitvertrag sind ein Debakel; die ÖBB Reform scheitert. Der einzige "Erfolg" des Kurzzeitministers lag im Bereich der Personalpolitik: Schmid holte sich Gerhard Sailer in das Ministerbüro. Laut Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstands war Sailer Gründungsmitglied der "Aktion Neue Rechte". Im Ministerium machte Sailer Karriere. Sailer wurde - ganz objektiv, versteht sich - von der Bewertungskommission des Ministeriums im Frühjahr 2003 für den Chefsessel der Abteilung für Nahverkehr vorgeschlagen.
Der Fall Monika Forstinger
Montag, 18. Februar 2002
Die nächste Infrastrukturministerin gibt auf. Dr. DI Monika Forstinger, Landschaftsplanerin aus Oberösterreich. Jahrgang 1963. Seit November 2000 FPÖ-Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie. Gerade 15 Monate – 455 Tage – dauerte die Karriere der begeisterten Jägerin als freiheitliche Infrastrukturministerin. FPÖ-Chefin Vizekanzlerin Susanne Riess-Passer gibt den Rücktritt der Oberösterreicherin bekannt. Schon nach den ersten 100 Tagen Amtszeit galt Forstinger als reif für den Rücktritt. Damals hatte die Ministerin die „Rufnummernverordnung“ erlassen, laut der in Österreich alle Telefonnummern geändert werden sollten. Nach heftiger Kritik aller Beteiligten musste die Ex-Ministerin die Verordnung wieder zurückziehen. Aufsehen erregte Forstingers Umgang mit ihren Mitarbeitern: Seien es die hohe Personalfluktuation in ihrem Büro, angebliche "Traumgagen" oder ein ihr nachgesagter "Anti-Stöckelschuherlass", der weiblichen Mitarbeitern rigide Kleidungsvorschriften auferlegte, wie es hieß. Häme und erste Assoziationen mit ihrem gescheiterten Vorgänger hatte die Ministerin allerdings bereits mit einem TV-Auftritt unmittelbar nach ihrer Angelobung geerntet: Ausgerechnet die Verkehrsministerin saß dabei ohne Gurt am Rücksitz eines fahrenden Autos. Die Partei kümmerte sich allerdings um die Ex-Ministerin. Ein Konsulentenvertrag der ÖBB half ihr finanziell über die Runden. Forstinger wurde 2003 beauftragt, für die ÖBB Grundstücke zu verwerten. Seither ist sie als Lobbyistin tätig.
Der Fall Peter Westenthaler
Sonntag, 8. September 2002
Der freiheitliche Klubobmann pfeift ab. Ing. Peter Westenthaler, Vorstand aus Wien. Österreichische Fußball-Bundesliga. Jahrgang 1967. Der gelernte Vorstand hatte innerhalb der FPÖ zahlreiche Funktionen: Pressesprecher, Landtagsabgeordneter, persönlicher Referent Jörg Haiders, Nationalratsabgeordneter, Generalsekretär. Der politische Abgang ist gut inszeniert. Nach einer parteiinternen Revolution treten Riess-Passer, Westenthaler und Grasser zurück. Westenthaler wird von Frank Stronach in die Fußball-Bundesliga geholt. Nach heftigen Scharmützeln mit einigen Klubpräsidenten und den glücklosen Verhandlungen über die TV-Rechte der Bundesliga - Westenthaler versuchte vergeblich dem ORF die Rechte der Spiele zu übertragen, den Zuschlag erhielt letztlich allerdings Premiere und ATV - erhielt Westenthaler die rote Karte. Stronach zieht ihn im August 2004 aus dem Bundesligavorstand ab und holt ihn nach Ebreichsdorf. Dort ist er derzeit als "Manager für spezielle Projekte im Bereich Magna Entertainment" mit Glückspiel und Pferden beschäftigt.
Der Fall Mathias Reichhold
Freitag, 28. Februar 2003
Das Infrastrukturministerium sucht wieder einen neuen Minister. Ing. Mathias Reichhold, Lehrer aus Kärnten. Jahrgang 1957. Seit Februar 2002 FPÖ-Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie muss seinen Posten räumen. Die Amtszeit Reichholds verläuft unspektakulär. Reichhold ist kein Minister mit großen Visionen. In der geplanten ÖBB-Reform verfolgt Reichhold einen Zick-Zack-Kurs. Einmal dagegen, dann wieder für die Reform. Einzige erkennbare Reform war die Verordnung für Führerscheinnachschulungen. Die Kurseinheit wurde mit 35 Euro festgelegt. Nicht sehr lange: Der Verfassungsgerichtshof hat auch diese Verordnung – neben zahlreichen anderen Verordnungen der Regierung Schüssel – als verfassungswidrig aufgehoben. Der Name des ehemaligen Referenten der Kärntner Landjugend fällt immer wieder im Zusammenhang mit der Nachfolge Rüdiger vom Walde. Reichhold – so der Wunsch der FPÖ – soll Chef der ÖBB werden. Schließlich landet der glücklose Verkehrsminister im Aufsichtsrat im Forschungszentrum Seibersdorf. Daneben findet er auch im Magna Konzern von Frank Stronach, der sich immer mehr zum Sammelbecken gescheiterter Politiker entwickelt, einen Platz.
Knittelfeld – Ein steirischer Ort macht Geschichte
Samstag, 7. September 2002
FPÖ Delegiertentreffen in Knittelfeld. Haider will die geplante Steuerreform verhindern. In Knittelfeld entgleitet ihm die Regie. In der FPÖ geht es rund. Es ist ein heißer Herbst für den kleinen Koalitionspartner. Die Nachrichtenagenturen müssen Sonderschichten einlegen.
Sonntag, 8. September 2002
Parteichefin Vizekanzlerin Susanne Riess-Passer, Finanzminister Karl-Heinz Grasser und Klubobmann Peter Westenthaler treten zurück.
Montag, 9. September 2002
Mathias Reichhold erklärt ebenfalls seinen Rücktritt.
Mittwoch, 11. September 2002
Der FPÖ-Vorstand nominiert einstimmig Jörg Haider als einzigen Parteiobmann-Kandidaten für den am 21. September stattfindenden Parteitag in Oberwart. Sozialminister Herbert Haupt wird zum designierten Spitzenkandidaten für die Nationalratswahl ernannt.
Freitag, 13. September 2002
Generalsekretär Karl Schweitzer erklärt sich zur Nachfolge von Westenthaler als FPÖ-Klubobmann bereit. Kärntens Landeshauptmann Haider erklärt seinen Verzicht auf ein Antreten als Parteiobmann beim bevorstehenden Parteitag. Später begründete Haider diesen Schritt mit angeblich massiven Bedrohungen seiner Person und seiner Familie durch die Waffenlobby im Zusammenhang mit der Abfangjäger-Beschaffung.
Montag, 16. September 2002
Das FPÖ-Parteipräsidium einigt sich nach siebenstündigen Beratungen auf Reichhold als Obmann-Kandidat.
Freitag, 20. September 2002
Parteivorstand und Bundesparteileitung wählen Reichhold zum Obmann.
Donnerstag, 31. Oktober 2002
Mathias Reichhold tritt nach nur 40 Tagen aus gesundheitlichen Gründen als Obmann und Spitzenkandidat zurück. Haupt wird neuer Spitzenkandidat der FPÖ. Die Folgen sind bekannt. Bundeskanzler Schüssel kündigt die Koalition auf und lässt am 24. November 2002 Neuwahlen durchführen. Das Ergebnis ist ernüchternd: Die ÖVP gewinnt rund 800.000 WählerInnen, die FPÖ verliert rund 750.000. Die ÖVP gewinnt 15,39 Prozent und legt auf 42,30 Prozent der Stimmen zu – die FPÖ verliert fasst 17 Prozent und fällt von 26,91 Prozent auf 10 Prozent hinunter. Jörg Haider ist erstmals angeschlagen. Noch hat er treue Freunde.
Donnerstag, 6.3.2003
Der Verein „Club Jörg“ wird offiziell vorgestellt. Volksanwalt Ewald Stadler und Harald Fischl geben die Begründung für diesen Schritt in einer Pressekonferenz bekannt. Vereinsziel ist „die Besinnung auf die Philosophie und politischen Visionen Dr. Jörg Haiders“.
DAS KABINETT SCHÜSSEL II
Freitag, 28. Februar 2003
Das schwarz-blaue Kabinett Schüssel II steht wieder vor der Angelobung. Bundespräsident Thomas Klestil ist wieder gefordert. Auf Vorschlag des Bundeskanzlers ernannte der Bundespräsident Mag. Herbert Haupt (FPÖ) zum Vizekanzler und Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen; Dr. Martin Bartenstein (ÖVP) zum Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit; Elisabeth Gehrer (ÖVP) zur Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur; Dr. Benita Ferrero-Waldner (ÖVP) zur Bundesministerin für auswärtige Angelegenheiten; Mag. Karl-Heinz Grasser („Parteilos“) zum Bundesminister für Finanzen; Dr. Ernst Strasser (ÖVP) zum Bundesminister für Inneres; Dr. Dieter Böhmdorfer (FPÖ) zum Bundesminister für Justiz; Maria Rauch-Kallat (ÖVP) zur Bundesministerin ohne Portefeuille; Hubert Gorbach (FPÖ) zum Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie; Günther Platter (ÖVP) zum Bundesminister für Landesverteidigung; Dipl. Ing. Josef Pröll (ÖVP) zum Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft.
Daneben ernannte der Bundespräsident Franz Morak (ÖVP) zum Staatssekretär im Bundeskanzleramt; Dr. Alfred Finz (ÖVP) zum Staatssekretär im Bundesministerium für Finanzen; Univ.Prof. Dr. Reinhart Waneck (FPÖ) zum Staatssekretär; Ursula Haubner (FPÖ) zur Staatssekretärin im Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen; Mag. Helmut Kukacka (ÖVP) zum Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie; Mag. Karl Schweitzer (FPÖ) zum Staatssekretär im Bundeskanzleramt.
Hubert Gorbach – Der Vielflieger
Hubert Gorbach, Exportmanager aus Vorarlberg. Jahrgang 1956. Hubert Gorbach ist der dritte Verkehrsminister, den die FPÖ bisher verbraucht hat. Gorbach fällt vor allem durch seine Vielfliegerei auf. Daneben versteht er es, in seinem Einflussbereich zahlreiche blaue Parteigänger unterzubringen.
Herbert Haupt – Der Mann in aller Klarheit
Mag. Ernst Herbert Haupt, Tierarzt aus Kärnten. Jahrgang 1947. Herbert Haupt hat mehrere Verkehrsunfälle, einen Flugzeugabsturz, einen Tauchunfall und zahlreiche FPÖ-Rochaden überlebt. Er wird bald für seine legendären Interviews („Ich sage das in aller Klarheit...“) berühmt. Die Schaffung einer Männerabteilung im Sozialministerium wird ihn wohl in die österreichischen Geschichtsbücher eingehen lassen. Am 21. Oktober 2003 – nach 242 Tagen Amtszeit – muss Herbert Haupt schließlich doch als Vizekanzler zurücktreten und wird durch Verkehrsminister Hubert Gorbach ersetzt. Die Sozialstaatssekretärin Ursula Haubner – Schwester von Jörg Haider – wird Haupt als geschäftsführende Parteiobfrau zur Seite gestellt.
Karin Miklautsch – Die Wasserreferentin
Mag. Karin Miklautsch, Juristin aus Kärnten. Jahrgang 1964. 1999 wurde sie zur Leiterin der Abteilung für Wasserrecht befördert. Seit 25. Juni 2004 ist Miklautsch – als Nachfolgerin von Böhmdorfer – Bundesministerin für Justiz. Miklautsch hatte keinen leichten Start. Von Jörg Haider als "Boxenluder" begrüßt, wird sie von den Strategen der Bundesregierung von der Öffentlichkeit weitgehend fern gehalten. Offenbar aus gutem Grund: Schlagzeilen erntete sie erstmals im Oktober 2004. In den heimischen Gefängnissen herrscht akuter Personalnotstand. Ihr Vorschlag, das Österreichische Bundesheer zur Bewachung der Gefangenen in den Gefängnissen einzusetzen, wurde nicht überall als gute Idee empfunden. Trotzdem wurde dieser Vorschlag im Dezember 2004 realisiert. Rund 100 Soldaten arbeiten derzeit in Niederösterreichs Gefängnissen. Der Militäreinsatz in Haftanstalten blieb bisher nur Militärdiktaturen vorbehalten.
Eduard Mainoni – Der Unbekannte
Mag. Eduard Mainoni, Jurist aus Salzburg. Jahrgang 1958. Eduard Mainoni forscht seit Juni 2004 im Wissenschaftsressort – von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt – vor sich hin. Staatssekretär Mainoni, selbst Salzburger, viel bisher nur im Zusammenhang mit der Rettung der Pinzgaubahn auf. Diese, so Mainoni im September 2004, ist für die nächsten 10 Jahre gerettet. FPÖ-Vorgänger Reinhart Waneck musste für Mainoni sein Amt als Gesundheits-Staatssekretär abgeben. Warum, weiß offenbar nur der Club Jörg.
Karl Schweitzer – Der Sportlehrer
Mag. Karl Schweitzer, Lehrer aus dem Burgenland. Jahrgang 1952. Seiner sportlichen Ausdauer verdankt er offenbar sein Amt. Mehrmals wollte der Club Jörg seinen Regierungssitz. Bei jeder Regierungsumbildung wird sein Name genannt. Ähnlich wie Kollege Haupt blieb er bisher jedoch immer im Amt. Wohl auch, weil auf seinem Nationalratsmandat der derzeitige Finanzreferent der Freiheitlichen sitzt. Und den braucht die FPÖ zur Schuldenverwaltung. Schweizer hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er sein Nationalratsmandat im Falle eines Rücktritts als Staatssekretär wieder übernehmen würde.
POSTEN, MACHT, GELD
Reinhard Gaugg – Der Promillegewerkschafter
1998 sorgte Reinhard Gaugg erstmals öffentlich für Aufsehen. Groß wurde von der FPÖ einen "Gegengewerkschaft" angekündigt. Der Gründungsvater der "Freien Gewerkschaft Österreichs" (FGÖ), die sich schließlich im Nichts auflöste, hatte auch in der Pensionsversicherungsanstalt wenig Glück. Das politische Sommerloch 2002 füllte wieder der FPÖ Nationalratsabgeordnete Gaugg. Der kurzzeitige Vizegeneraldirektor der Pensionsversicherungsanstalt und FPÖ-Abgeordneter will auf sein Nationalratsmandat nicht verzichten. Auch die Verhandlungen um das Gehalt (Sondervertrag in der Höhe von 7.900 Euro) spießen sich und werden öffentlich ausgetragen. Schließlich wird Gaugg von seinen eigenen Parteifreunden aus dem Verkehr gezogen. Gaugg wird in Kärnten mit etwas zu viel Alkohol am Steuer erwischt. Er verweigert den Alkotest. Aus gutem Grund. Den Rest erledigt der Club Jörg.
Minderheitenschutz beim Postenschacher
Die ÖVP – und früher auch die SPÖ – haben es über Jahrzehnte gelernt, nachhaltige Postenbesetzungen durchzuführen. Bünde, CV, Vereinigungen, Kammern und parteinahe Vorfeldorganisationen sorgen für die notwendigen Seilschaften. Der FPÖ fehlt diese Tradition. Die Volkspartei betreibt seit Jahrzehnten klassische nachhaltige Interessenspolitik. Die FPÖ ist nur an Posten, Versorgungsämter und Geld interessiert. Ob ÖIAG, ÖBB, Sozialversicherung oder Ministerien: überall werden FPÖ Freunde untergebracht. Die ÖVP macht es leise und besetzt Posten nach ihren Interessen. Die FPÖ hat noch weniger Erfahrung damit. Dadurch fällt es auf, wenn FPÖ-Skilehrer plötzlich im Hauptverband der Sozialversicherung auftauchen. Überall wo sich FPÖ Funktionäre hineindrängen, ist die ÖVP schon dort. Mehrheitlich, versteht sich. Damit der kleine Koalitionspartner nicht aufmuckt gibt es den so genannten „Minderheitenschutz“ für Freiheitliche.
Herbert Haupt versteht es, im Sozialministerium relativ rasch Freiheitliche unterzubringen. Gut dotiert, versteht sich. Für Aufsehen sorgt im März 2001 die Kabinettsmitarbeiterin Ute Fabel. Haupts Mitarbeiterin erhält eine Spitzengage. Allein für den Februar 2001 überweist ihr das Sozialministerium ein Gehalt von 20.130 (!) Euro. Einziger Schönheitsfehler: Frau Magistra, wie sie sich im Amt nennt, ist keine Akademikerin. Neben der Leitung der "Männerabteilung" wird auch die Seniorenabteilung mit einer blauen Leitung besetzt. Weitere FPÖ Mitarbeiter im Sozialministerium: Harald Kosobud; Günter Kasal (FPÖ-Bezirksrat in Wien); Eva Engl-Eckhart; Katharina Pawkowicz; Thomas Kaumberger.
Der Hauptverband der Sozialversicherungsträger besteht insgesamt aus 4 Geschäftsführer: eine davon ist die freiheitliche Mag. Beate Hartinger. Der Hauptverband besteht daneben aus 14 so genannten Verwaltungsräten – 2 davon darf die FPÖ stellen: einer ist Skilehrer aus Kärnten, Herbert Tieflinger, der zweite Manfred Mischelin. Der FPÖ-Mann Mag. Erich Nischelbitzer war für das Debakel bei der Chipcard – die Jörg Haider öffentlich scharf kritisierte – verantwortlich. Kein Problem: Nischelbitzer sitzt nach wie vor im Hauptverband.
Hubert Gorbachs Infrastrukturministerium gilt als Tummelplatz für blaue Parteigänger. Für den Chefposten in der Sektion III (Forschung, Post und Telekom) hat sich im Oktober 2004 Gorbachs Vize-Kabinettschef Andreas Reichhardt beworben. Reichhardt hat zwar nichts mit Forschung zu tun, aber er kommt aus dem Büro von Thomas Prinzhorn. Das qualifiziert. Im Jänner 2005 wird der Chefposten für die „Schienen Controll GmbH“ besetzt. Auffallend im Ausschreibungstext: „kein Hochschulabschluss notwendig“. Klar: Georg Fürnkranz hat keinen Hochschulabschluss. Fürnkranz war FPÖ-Vize-Klubdirektor und Kabinettschef von Verkehrsminister Hubert Gorbach. Die Infrastruktursektion im Gorbach-Ministerium ist bereits mit dem Tiroler FPÖ Mann Arnold Schiefer besetzt. Auch FPÖ nahe Unternehmen erhalten ein Stück vom ÖBB-Kuchen. Die Werbeagentur von Jörg Haiders Intimus Gernot Rumpold „MediaConnection“ soll – so das Nachrichtenmagazin profil im November 2004 – einen lukrativen ÖBB-Auftrag erhalten. Dies, obwohl das Angebot in allen Punkten das Schlechteste war. Das Angebot müsste nach objektiven Kriterien als zu teuer und zu unkonkret ausgeschieden werden. Rumpold hat nur einen Vorteil: die Entscheidung über die Vergabe trifft sein Parteifreund, ÖBB Manager Gilbert Trattner.
Das Forschungszentrum Seibersdorf wurde still und leise mit blauen Parteigängern eingefärbt. Die Industrie hält an den Austrian Research Centers in Seibersdorf 49 Prozent. Mehrheitseigentümer – 51 Prozent – ist der Bund. Mit dem Ex FPÖ Verteidigungsminister Helmut Krünes als Geschäftsführer und dem Leiter der Business Service, Martin Graf, ziehen 2004 zahlreiche Blaue in das Forschungszentrum. Um den begehrten Geschäftsführerposten, der 2005 ausläuft, wird bereits jetzt heftig gerittert. Krünes gegen Graf heißt das derzeitige Match. Die FPÖ Seilschaften haben bereits mehrere Kandidaten in Stellung gebracht. So viele, dass sich die Blauen selbst in die Quere kommen. Neben Martin Graf hoffen auch Andreas Reichhardt und Peter Franzmayer aus dem Kabinett Gorbach auf den Posten von Krünes. In Seibersdorf ist seither die Dichte der Mitarbeiter mit „Rasierfehler“ (hausinterner Jargon für Freiheitliche mit Schmiss) enorm gestiegen. Graf ist Mitglied der Akademischen Burschenschaft Olympia Wien. Forschung ist seit Knittelfeld bekanntlich eine Domäne der Freiheitlichen. Im Aufsichtsrat sitzt neben Ex-Verkehrsminister Mathias Reichhold auch Andreas Reichhardt (Stellvertretender Kabinettschef von Infrastrukturminister Hubert Gorbach). Reichhardt ist Mitglied der Grenzlandsmannschaft Cimbria Wien. Den Bereich Personalentwicklung deckt die frühere Assistentin Reichholds, Iris Klein, ab. Für den Weltraum ist der ehemalige Referent Reichholds, Heinz Gabernig, zuständig. Auch der ehemalige FP-Wissenschaftssprecher Martin Graf holte sich gleich mehrere Parteifreunde nach Seibersdorf: Alfred Wansch - Wohnungskommissionsmitglied der FPÖ-Donaustadt (!) – leitet die Rechtsabteilung in Seibersdorf. Arnulf Helpersdorfer (Ex-RFS-Vorsitzender, Mitglied der Burschenschaft Gothia), Julian Korisek (FPÖ Graz) und Mark Perz (RFS Graz) bereichern Wanschs Division.
Auch der Rechnungshof erhält Verstärkung aus der FPÖ. Der ehemalige Klubdirektor des FPÖ-Parlamentsklubs – Josef Moser – wird Präsident des Rechnungshofes. Sein Nachfolger im Parlamentsklub wurde Rupert Prochaska. Moser holte sich Prochaska schließlich im Oktober 2004 in sein Kabinett.
Montag, 11. Oktober 2004
Das Ende vom "Club Jörg". Der Verein "Club Jörg" hat sich aufgelöst. Club-Präsident Harald Fischl bestätigt den Medien das Ende des Vereins. Die Auflösung wird damit begründet, dass der Haupt-Vereinszweck, die Rückkehr von Jörg Haider an die Spitze der Bundespartei, "regelrecht obsolet geworden ist".
(Buchbeitrag: Politische Kultur in Österreich 200-2005, Nikolaus Dimmel/Josef Schmee (Hg.) Promedia 2005)
Rudi Leo - 21. Dez, 12:19
